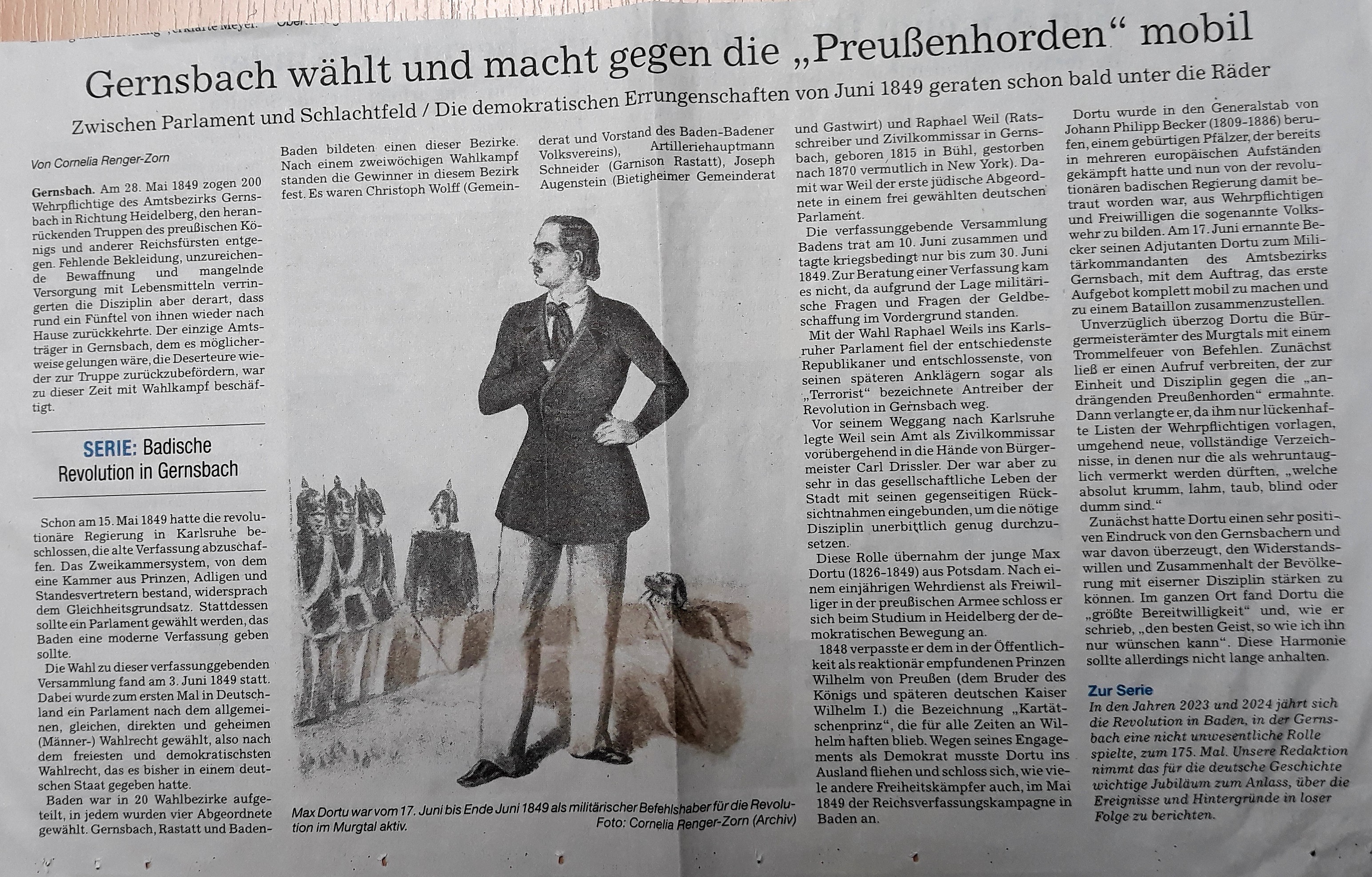|
Barrikadenwein und Kartätschenwürste. Wienerle mit Knalleffekt
„Barrikaden-Wein zu 3 kr. und Kartätschen-Würste, neueste Wiener; sind probat“. So annoncierte Gustav Wallraff, Wirt der Gaststätte „Zum Badischen Hof“ in der Gernsbacher Amtsgasse, in der Wochenzeitung „Wächter an der Murg“ vom 22. Oktober 1848. Mit „probat“ (lateinisch „geeignet“, „tauglich“) unterstrich er die Qualität seiner Würste. Die provokante Bezeichnung der angebotenen Speisen (Kartätsche bezeichnet ein Artilleriegeschoss mit Schrotladung) kam nicht von ungefähr.
Zunächst ist interessant, dass Wallraff seine Würstel überhaupt „Wiener“ nannte. Laut der Webseite des österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft handelt es sich dabei um die seit dem Mittelalter in Deutschland bekannten Frankfurter Würstchen, deren Wiener Variante um 1805 von dem Metzger Johann Georg Lahner erfunden wurde, der in Frankfurt sein Handwerk gelernt und sich später in Wien niedergelassen hatte. Der Erfolg seiner „Frankfurter Würstel Wiener Art“ war so groß, dass sie bald in der ganzen Welt als „Wiener Würstel“ bekannt wurden. Seit 1842 sind sie in Mailand, seit 1861 in Amsterdam und spätestens seit 1848 also auch in Gernsbach als „Wiener“ bekannt!
Der Preis für den „Barrikaden-Wein“ lag laut dem Bericht des „Wächters“ über die Weinernte in der Region mit drei Kreuzern nur leicht über dem Handelspreis für den Schoppen Wein (0,596 Liter) von 2,5 bis 2,8 Kreuzern. Was die angepriesenen „Kartätschen-Würste“ kosteten, wird nicht angegeben. Ihre Bezeichnung als „neueste Wiener“ charakterisierte die Wurst wahrscheinlich nach ihrem Unterschied zum „Frankfurter Würstchen“, das kein Rindfleisch enthielt. Wallraff hatte aber sicher noch einen anderen Zusammenhang im Auge.
Der ausführliche Leitartikel des „Wächters“ der Ausgabe vom 22. Oktober befasste sich mit „Oesterreich’s Lage“. Die Zustände in der Donaumonarchie hatten sich seit März 1848 zu einem gefährlichen Brennpunkt für die Demokratiebewegung auch in Deutschland entwickelt. In Wien war es im März 1848 zu Aufständen gekommen, bei denen Bürger, Studenten und Arbeiter mehr Freiheit und politische Mitsprache forderten. Der Kaiser hatte Pressefreiheit und eine Verfassung versprochen, Staatskanzler Metternich, die Symbolfigur für das System der Unterdrückung, hatte das Land verlassen. Während die Bürger nun weitgehend zufrieden waren, kämpften Studenten und Arbeiter nun im sogenannten Wiener Oktoberaufstand 1848 für eine Aufrechterhaltung der Demokratisierung, soziale Gerechtigkeit und das Selbstbestimmungsrecht der Ungarn, die sich gegen die Herrschaft des Habsburger Regimes auflehnten. Es kam zu blutigen Kämpfen um Wien, wo wieder Barrikaden gebaut wurden und Kartätschen knallten. Gegen den heftigen Widerstand großer Teile der Bevölkerung zwang Alfred Fürst Windischgrätz, der vorher den Aufstand der Tschechen in Prag niedergeschlagen hatte, auch die Stadt Wien am 31. Oktober zur Kapitulation.
Der „Wächter“ beschrieb die aktuelle Lage in Wien ziemlich genau und kam zu dem Schluss, „daß Wien dazu auserkoren sei, nicht allein den Kampf für die Freiheit, sondern auch für die Nationalität der östreichischen Völker führen zu müssen“. Die Zeitung sah die Gefahr, dass der österreichische Vielvölkerstaat in seine nationalen Bestandteile zerfallen könnte. Im anschließenden Lagebericht eines Korrespondenten in Wien heißt es prophetisch: „In den Flächen um Wien wird sich Deutschlands Schicksal entscheiden.“ Diese Einschätzung der Redaktion des „Wächters“ am 22. Oktober 1848 sollte sich im Nachhinein als richtig erweisen: Mit dem Sieg der Reaktion in Wien wurde auch die Reaktion in Deutschland enorm gestärkt, so dass ein Erfolg der Demokratie- und Verfassungsbewegung gegen die wieder erstarkten Fürsten schon am Ende des Jahres 1848 in bedenklich weite Ferne rückte.
Die provokante Bezeichnung, die Gustav Wallraff im Oktober 1848 für seinen Wein und seine Würste wählte, zeigt, dass er die politischen Vorgänge auch im Ausland genau registrierte und den Einsatz von Gewalt als letztes Mittel zur Rettung der Demokratiebewegung gegen den Widerstand der Fürsten befürwortete oder zumindest billigend in Kauf nahm. In Anbetracht der Tatsache, dass seit März 1848 in Berlin, Wien und anderen Städten viele Barrikadenkämpfer ihr Leben verloren hatten, war seine knallige Werbung nicht besonders feinfühlig, aber soweit hatte er wahrscheinlich gar nicht gedacht. Selbst seine Gegner charakterisierten ihn später als „redlichen und gutmüthigen Mann von leicht erregbarem Temperament“. Dass schon bald auch in Gernsbach Barrikaden gebaut und Kartätschen fliegen würden, damit rechnete er gewiss nicht ernsthaft.
Totenfeier für Robert Blum spaltet Gernsbach.
„Am 9. Nov. 1848, Morgens halb 8 Uhr, wurde in Wien der Reichstagsabgeordnete Robert Blum auf Befehl des kais. kön. (kaiserlich-königlichen) Feldmarschalls, Fürsten zu Windischgrätz, erschossen“. So begann der schwarz umrandete, mehr als ganzseitige Nachruf im Gernsbacher Wochenblatt „Wächter an der Murg“ vom 26. November 1848. In der Folge wurden in vielen deutschen Städten Trauerfeiern für den wohl prominentesten demokratischen Abgeordneten der Frankfurter Paulskirche organisiert – auch in Gernsbach, dort allerdings mit einer für den Frieden der Stadt unheilvollen Wirkung.
Robert Blum, 1807 in Köln geboren, stammte aus ärmlichsten Verhältnissen. Der Besuch einer höheren Schule war ihm nicht möglich. Seine Bildung verdankte er einem unermüdlichen Selbststudium. Er erlernte zunächst das Handwerk des Gelbgießers (Herstellung von Gürtelschnallen aus Messing), arbeitete sich zum Angestellten eines Laternenfabrikanten, Theatersekretär am Leipziger Stadttheater, Journalisten und Schriftsteller hoch und machte sich schließlich als Verleger in Leipzig selbständig. Dank seines außergewöhnlichen Organisations- und Rednertalents wurde ihm die Politik zur Berufung. Als Mittelpunkt eines weitverzweigten demokratischen Netzwerkes wurde er 1848 als einer der ganz wenigen Nicht-Akademiker in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt. Blum war Republikaner und Sozialreformer, aber daneben auch ein Pragmatiker, der Gewalt grundsätzlich ablehnte und immer zu Kompromissen bereit war – so lange, bis keine Kompromisse mehr möglich waren.
Im Oktober 1848 kam es in Wien zu einem erneuten Aufstand gegen das kaiserliche Regime, das seine absolutistische Machtvollkommenheit wieder herstellen wollte. Blum erkannte, dass dieses Regime gar keinen Kompromiss wollte. Die republikanisch gesinnten Gruppierungen der Paulskirche schickten vier Gesandte nach Wien, darunter Blum, um den Aufständischen ihre Solidarität auszusprechen. Blum empfand dieses Vorgehen als legitim, da es ja die kaiserliche Regierung war, die sich nicht an das Recht hielt und stattdessen ihre Untertanen massakrierte. Als die Gesandten nicht mehr aus dem belagerten Wien herauskamen, griff Blum schließlich selbst zur Waffe, um bei der Verteidigung der Stadt mitzuhelfen. Dafür wurde er nach der Kapitulation standrechtlich in der Brigittenau (heute ein Stadtteil im Norden Wiens) erschossen, obwohl Zehntausende dasselbe getan hatten, ohne belangt zu werden, und obwohl er als Abgeordneter der Paulskirche Immunität genoss.
Durch ganz Deutschland ging ein Aufschrei der Wut und des Entsetzens. Robert Blum war im öffentlichen Bewusstsein ein Märtyrer der Freiheit. Deutschlandweit kam es zu zahlreichen Gedenkfeiern, in der Region unter anderem in Baden-Baden, Bühl, Steinbach, Rastatt und Karlsruhe. In Gernsbach wurde die Feier von den demokratisch gesinnten Bürgern Franz Kürzel, Wilhelm Seyfarth, Casimir Griesbach und Christian Bucherer organisiert. Sie fand am Sonntag, den 3. Dezember statt. Der „Wächter“ berichtete ausführlich darüber am 10. Dezember. Die Teilnehmer sammelten sich vor dem (Alten) Rathaus, von wo ein aus mehreren hundert Menschen bestehender Trauerzug zum Kornhaus zog, wo der eigens angereiste zuständige Landtagsabgeordnete, der republikanisch gesinnte Pfarrer Friedrich Lehlbach, Blum in so mitreißenden Worten würdigte, dass laut „Wächter“ „ungeachtet des unausgesetzt strömenden Regens das Volk beharrlich und aufmerksam“ lauschte. Eine Abordnung Badener Turner mit Musikkapelle wurde mit Jubel begrüßt. Geplant war auch die geschlossene Teilnahme der Gernsbacher Bürgerwehr, um die Einheit der demokratisch Gesinnten zu demonstrieren. Dieser Plan scheiterte allerdings.
Murgschiffer Wilhelm Grötz, der Kommandant der Bürgerwehr, weigerte sich, der Truppe das geschlossene Antreten zu befehlen und nahm auch selbst nicht an der Feier teil. Etliche Offiziere und Mannschaften taten es ihm gleich, so dass die Bürgerwehr bei der Blum-Feier große Lücken in ihren Reihen aufwies. Selbst die Musikkapelle war nicht vollständig, da die acht zur Kapelle gehörigen Trommler einschließlich Tambourmajor (Anführer der Musiker) fehlten. Der „Wächter“ berichtet von „Intrigen“ der „Schreibstubenherrschaft“. Damit war das Gernsbacher Bezirksamt gemeint, das „alles aufgeboten“ habe, „um die Feier zu hintertreiben“ und „Zwietracht unter die Bürgerwehr zu schleudern“. Ein Beobachter, so bemerkte der „Wächter“, hätte am 3. Dezember den „großen Prinzipienkampf unserer Tage auf den Straßen unserer Stadt sich im Kleinen abspiegeln sehen können.“ Am Schicksal Robert Blums zeigte sich in der Tat der große Gegensatz von 1848/49, nämlich der zwischen der demokratischen Umformung des politischen Lebens und der Rückkehr zum alten System des Absolutismus. Blum hatte erkannt, dass die Zusammenarbeit mit den alten Mächten keine Alternative sein konnte. „Ich sterbe für die Freiheit, möge das Vaterland meiner eingedenk sein“, soll er vor seiner Hinrichtung gesagt haben. In Gernsbach führte die Würdigung seiner Person zu einer tiefen Spaltung innerhalb der Bürgerschaft, was sich bald besonders am Kampf um die Bürgerwehr zeigen sollte.
Ordnung oder Terror. Gernsbach zerfällt in verfeindete Lager
Die Gedenkfeier für den vom österreichischen Gewaltregime erschossenen Paulskirchenabgeordneten Robert Blum führte seit Ende 1848 zu einem immer tiefer werdenden Riss innerhalb der Gernsbacher Bürgerschaft. Die konservativ Gesinnten traten aus der Gernsbacher Lesegesellschaft aus. Die Republikaner gründeten im Januar den Gernsbacher Turnverein, die Konservativen schlossen sich im Februar 1849 zum „Vaterländischen Verein“ als Gegenoffensive zusammen. Besonders um die Bürgerwehr tobte ein erbitterter Streit.
Murgschiffer Wilhelm Grötz (1812-1872), Gernsbacher Gemeinderat und gewählter Kommandant der Bürgerwehr, hatte sich am 3. Dezember geweigert, seine Truppe geschlossen zur Trauerfeier für Robert Blum antreten zu lassen (wir berichteten). Grötz war hälftiger Eigentümer des Hauses in der heutigen Hauptstraße 21, wo er laut Volkszählung von 1848 mit Ehefrau und drei Kindern wohnte. Sein Vater Benedikt (1788-1857), der am Markt ein ganzes Haus besaß, versteuerte 1839 ein Kapital von 27.125 Gulden und rangierte damit in ähnlichen Vermögensverhältnissen wie die führenden Murgschiffer Kast und Katz. Wilhelm Grötz war den modernen Bestrebungen nach mehr politischer Teilhabe durchaus aufgeschlossen, wie sein Eintritt in die Gernsbacher Lesegesellschaft 1847 zeigt. Er war aber auch ein typisches Beispiel für die (meist begüterten) Bürger, die ein Vorgehen gegen die etablierte Staatsgewalt und damit gegen Recht und Ordnung strikt ablehnten. Mit Robert Blum konnte er sich nicht identifizieren, da dieser beim Kampf um Wien bewaffneten Widerstand gegen die kaiserliche Regierung geleistet hatte.
Diejenigen Offiziere und Unteroffiziere, die, ähnlich wie Robert Blum, in der österreichischen Regierung ein Unrechtsregime erblickten, traten nach der Blum-Feier aus der Bürgerwehr aus, mit dem Effekt, dass sich die konservativen Kräfte umso fester um Wilhelm Grötz zusammenschlossen. Immerhin waren das nach einem Bericht des Amtmanns Louis Dill vom 7. Februar 1849 noch 150 Mann, also ungefähr die Hälfte der gesamten Bürgerwehr. Der Amtmann sah in dem Zerfall in zwei verfeindete Lager sogar einen „Gewinn für die gute Sache“, da „jede Neutralität bisher nur zum Übel“ ausgeschlagen sei, also nun keine Kompromisse mehr nötig seien. Es kam zu weiteren Auseinandersetzungen um die Bürgerwehr und ihren Kommandanten.
Bürgermeister Carl Drissler hatte bereits vor der Blum-Feier von den Bürgerwehr-Männern verlangt, ihre Gewehre zu bezahlen oder zurückzugeben. Dabei wollte er wohl in erster Linie die Kostenfrage klären, da die Gewehre anfänglich von der Gemeindekasse bezahlt worden waren, laut Bürgerwehr-Gesetz vom 1. April 1848 aber grundsätzlich von den einzelnen Wehrmännern bezahlt werden mussten. Die Kosten durften nur von der Kasse der Bürgerwehr oder der Gemeindekasse übernommen werden, wenn ein Bürgerwehrmann zu arm war, seine Waffe selbst zu bezahlen. Als Drissler dieses Verlangen nach der Blum-Feier wiederholte, witterte Amtmann Dill, selbst Mitglied der Bürgerwehr, sofort ein Manöver zur Entwaffnung des konservativen Teils der Bürgerwehr: „Man wollte dadurch, weil voraussichtlich für die meisten eine Bezahlung in dieser Zeit der Noth nicht möglich war, der Bürgerwehr auf geschickte Weise die Gewehre aus der Hand spielen“, wie Dill an das Innenministerium schrieb. „Wir würden“, so prophezeite er düster, „unbezweifelt einer kleinen terroristischen Parthei verfallen, würde eine Waffenauslieferung stattfinden“. Kommandant Grötz pflichtete dieser Einschätzung bei: „Das hiesige Bürgermeisteramt geht damit um, die hiesige Bürgerwehr im Sinne der ´Rothen` zu entwaffnen“. Die Konservativen, denen die bestehende Ordnung heilig war, betrachteten die Befürworter der Republik also nun als eine rote Terrororganisation!
Der Gemeinderat, in dem die demokratischen Mitglieder zusammen mit dem Bürgermeister meist die Mehrheit hatten, beschwerte sich daraufhin beim Innenministerium in Karlsruhe über die „Willkür“ und „unbefugte Einmischung“ von Seiten Dills. Die konservative Rumpf-Bürgerwehr beschloss am 8. Mai 1849, kurz vor Ausbruch der Revolution, die in Frankfurt erarbeitete Reichsverfassung für ein geeintes Deutschland „gegen jeden verfassungsverletzenden Angriff zu vertheidigen“. Dieses Ziel verfolgten letztlich auch die Republikaner. Dennoch gelang keine Einigung. Die Mehrheit des Gemeinderats strebte eine Neuorganisation der Bürgerwehr unter einem anderen Kommandanten an, der konservative Teil der Bürgerwehr hielt an Grötz fest und forderte ihn auf, „den einseitigen Beschlüssen des Parthei ergreifenden Gemeinderathes keine Folge zu leisten“. Die Differenzen waren unüberbrückbar, selbst als es um die Rettung der Reichsverfassung ging. Insofern spiegelte Gernsbach im Kleinen wider, was auf Reichsebene zum Scheitern der Bewegung von 1848/49 beitrug. In den im Juni 1849 folgenden Kämpfen an der Murg spielte die Bürgerwehr keine Rolle mehr.
Vorbereitung der Jugend für den Kampf. Der Gernsbacher Turnverein.
Am 27. Dezember 1848 wurden die „Grundrechte des deutschen Volkes“ von der Frankfurter Nationalversammlung in Kraft gesetzt. Die in Gernsbach erscheinende Zeitung „Wächter an der Murg“ kommentierte diese Sternstunde der Demokratie wie folgt: „Die Grundrechte, welche das Gesamtvolk durch seine Vertreter festgestellt hat, sind die Magna Charta Deutschlands“. Würden die Fürsten sich an ihre Zusagen vom März 1848 halten und sie in ihren Staaten als Gesetz einführen?
Großherzog Leopold von Baden erkannte die Grundrechte an und ließ sie am 18. Januar 1849 im Regierungs-Blatt als Gesetz veröffentlichen. Österreich und Preußen, die beiden größten Mächte im deutschen Bund, sowie Bayern und Hannover lehnten die Grundrechte dagegen ab. Damit war die Bildung eines einheitlichen deutschen Staates mit einer die Monarchie einschränkenden Verfassung in weite Ferne gerückt. Die Liberalen wollten die Hoffnung nicht aufgeben, dass doch noch eine Einigung mit den Fürsten zustande kommen würde, während die Republikaner verstärkt den Widerstand organisierten. In Baden kam es durch das Grundrecht der Versammlungs- und Vereinsfreiheit Anfang 1849 zu einer Welle von Neugründungen republikanisch-demokratischer Volksvereine. Auch in Gernsbach wurde im Januar 1849 ein demokratischer Verein gegründet, allerdings kein Volksverein, sondern ein Turnverein. Zweck der von „Turnvater“ Ludwig Friedrich Jahn (1778-1852) seit 1811 propagierten Turnbewegung war nicht nur die Förderung der Gesundheit, sondern auch die Erhöhung der Wehrtauglichkeit (zu dieser Zeit für den Kampf gegen die napoleonische Herrschaft).
Dass der Gernsbacher Turnverein ähnlich wie die Volksvereine demokratisch-republikanisch orientiert war, machte der Gernsbacher Amtmann Louis Dill klar, als er ihn abschätzig als „Brentano-Verein“ titulierte. Der 1813 in Mannheim geborene Lorenz Brentano (Jurist und Paulskirchenabgeordneter) war gerade zum Vorsitzenden des provisorischen Landessausschusses der badischen Volksvereine gewählt worden. Zum Vorsitzenden des Gernsbacher Turnvereins wurde der Murgschiffer Casimir Griesbach gewählt. Innerhalb kurzer Zeit traten bereits etwa 80 Bürger bei, also rund 21 Prozent der 374 wahlberechtigten Bürger. Die Mitgliederliste umfasste in erster Linie Handwerker, gefolgt von Kaufleuten und Gastwirten. Öffentliche Bedienstete wie Ratsschreiber Raphael Weil und Polizeiwachtmeister Wilhelm Rothengatter waren dagegen Ausnahmen. Man findet auch Söhne von konservativ gesinnten Vätern im Turnverein, zum Beispiel Friedrich Kaufmann, Sohn des jüdischen Händlers Simon Kaufmann, oder Casimir Kast, Sohn des gleichnamigen Murgschiffers.
Der heutige Turnverein Gernsbach 1849 e. V. betrachtet den 30. Januar 1849 als offizielles Gründungsdatum, da die Satzung dieses Datum trägt. Bereits am 18. Januar wurde aber schon ein Turnerball im „Badischen Hof“ in Gernsbach gefeiert, worüber der „Wächter“ in höchsten Tönen berichtete. Es gab Musik und „das Auge ergötzende Turnübungen“, aus Baden-Baden begrüßte man die badischen Turner. Ratsschreiber Weil hielt eine Rede, in der er den Zweck des Vereins dahingehend definierte, dass „die deutsche Jugend sich stähle für den unausbleiblich bevorstehenden Kampf“. Weil rechnete also damit, dass ein bewaffneter Kampf nötig sein würde, um die deutsche Einigung durchzusetzen. Zahlreiche Toasts wurden ausgebracht mit dem Gruß „Gut Heil“, der bereits aus dem Mittelalter bekannt war und sich seit 1846 in den Turnvereinen durchgesetzt hatte. Die Satzung des Vereins enthielt einen Passus dahingehend, dass „jedes Mitglied, welches sich erwiesenermaßen einer Ausbreitung der inneren Angelegenheiten schuldig macht, aus dem Verein ausgeschlossen wird“. Neben dem Turnen waren auch politischer Austausch und Bildung wichtig. Der „Wächter“ vom 28. Februar kündigt „Vorträge aus dem Gebiete der Geschichte, Geographie, Naturkunde, Politik, insbesondere Tagespolitik“ an und für die Jüngeren zwischen 16 und 20 Jahren „auf geäußerten Wunsch“ Kurse in Deutsch und Französisch.
Nicht in den Turnverein aufgenommen wurden auf Betreiben von Ratsschreiber Raphael Weil die Mitglieder des Gernsbacher Arbeitervereins. Der hatte sich Anfang 1849 gebildet und bestand vorwiegend aus auswärtigen Handwerksgesellen und Hilfskräften. Für den Fall ihrer Aufnahme hatten bereits mehrere Turner ihren Austritt angekündigt. Weil fürchtete um die Anziehungskraft des Turnvereins. Dessen Mitglieder waren eben nicht nur Demokraten, sondern auch etablierte Bürger, die sich gegen eine vermeintlich radikale Unterschicht abgrenzen wollten. Der Grundsatz der Gleichheit galt eben nicht für alle. Weil nahm aus taktischen Gründen Rücksicht auf die Vorurteile seiner Vereinskollegen. Was den Arbeitern allerdings zugestanden wurde, waren Vergünstigungen wie die kostenlose Benutzung des Turnplatzes oder der freie Eintritt zu Turnerbällen.
Angst vor der “Pöbelherrschaft”. Der Vaterländische Verein verteidigt das alte Regime.
Im Januar 1849 hatten sich die Gernsbacher Republikaner zum Turnverein zusammengeschlossen. Dagegen bildeten die Konservativen, darunter auch die großherzoglichen Beamten, im Februar 1849 den „Vaterländischen Verein“, der das bestehende Regime verteidigte, da man auf diese Weise die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung am ehesten gewahrt glaubte.
Am 14. Februar 1849 inserierte Heinrich Heidinger, der Wirt des Gasthauses „Krone“ an der Hofstätte in Gernsbach in dem mittlerweile zweimal in der Woche erscheinenden Blatt „Wächter an der Murg“: „Bei Kronenwirth Heidinger ist ganz vortreffliches Turnerbier aus dem besten Aristokraten-Keller zu haben; es braucht sich also auch kein Mitglied des neuerrichteten Vaterländischen Vereins zu schämen, dieses Bier zu trinken.“ Der republikanisch gesinnte Kronenwirt unterstellt seinen Gästen aus dem konservativen Lager hier nicht ohne Ironie, sich gegenüber den „Normalbürgern“ der Mittel- und Unterschichten als „etwas Besseres“ vorzukommen. Tatsächlich wurde in konservativen und gemäßigt-liberalen Kreisen die Republik oftmals mit „Pöbelherrschaft“ gleichgesetzt. Das Trauma der Französischen Revolution und ihrer Terrorherrschaft saß eben noch sehr tief. Vielen Bildungsbürgern missfiel außerdem die lautstarke politische Agitation der Republikaner, die sich bemühten, mit Hilfe von Zeitungen, Vereinen und Volksversammlungen eine möglichst breite Massenbasis aufzubauen, da sie in der Frankfurter Nationalversammlung in der Minderheit waren.
In Gernsbach machten die regimetreuen, also „aristokratisch“ gesinnten Konservativen im „Vaterländischen Verein“ Front gegen die hauptsächlich aus kleinbürgerlichen Schichten stammenden Republikanhänger. Der „Vaterländische Verein“ war ein Ableger des gleichnamigen Vereins in Rastatt. Gemeinsam gaben die beiden Vereine seit Anfang April 1849 ein zweimal die Woche erscheinendes Blatt heraus, den „Murgboten“. Vorsitzender in Rastatt war Professor Franz Kuhn, Lehrer am Lyzeum Rastatt (seit 1908 Ludwig-Wilhelm-Gymnasium). Nach einem zeitgenössischen Bericht von Carl Borromäus Alois Fickler (Historiker und ebenfalls Lehrer am Lyzeum Rastatt) gehörten dem Verein in Rastatt überwiegend konservative Bürger, Offiziere, Beamte und Staatdiener an. In Gernsbach verhielt es sich ähnlich. Amtmann Louis Dill berichtete am 12. Februar 1849 an das Innenministerium nach Karlsruhe, am 10. Februar habe sich unter Beteiligung von „vielen wackren Bürgern dahier sowie sämtlichen hiesigen Staatsdienern und übrigen Bediensteten“ ein „Gegenverein“ (gemeint war der „Vaterländische Verein“) gebildet. Zum Vorsitzenden wurde Bürgerwehrkommandant und Murgschiffer Wilhelm Grötz gewählt.
Eine der ersten Aktionen des „Vaterländischen Vereins“ war die Absendung einer Petition (Bitte) an die großherzogliche Regierung, den badischen Landtag nicht aufzulösen. Dies war eine Reaktion auf die kurz vorher erfolgte Petition der Gernsbacher Demokraten um Bürgermeister Carl Drissler, die das Gegenteil, nämlich eine Auflösung des Landtags, beantragt hatten. Der Streit hing mit den neuen „Grundrechten des deutschen Volkes“ zusammen. Der von der Frankfurter Nationalversammlung am 27. Dezember 1848 als Reichsgesetz verabschiedete und von Großherzog Leopold im Januar 1849 für Baden als Gesetz anerkannte Grundrechtskatalog bestimmte in Paragraph 137: „Vor dem Gesetz gilt kein Unterschied der Stände. Der Adel als Stand ist aufgehoben. Alle Standesvorrechte sind abgeschafft. Die Deutschen sind vor dem Gesetze gleich.“
Das Gesetz war zukunftsweisend, Weimarer Verfassung und Bonner Grundgesetz nahmen es zum Vorbild. Die Verwirklichung hätte aber 1849 eine tiefgreifende Änderung des Regierungssystems bedeutet. Die beiden Kammern des badischen Landtags entsprachen nicht dem Grundsatz der Gleichheit. In der ersten Kammer saßen die Prinzen des großherzoglichen Hauses und andere Vertreter des Adels. Die zweite Kammer bestand aus gewählten Abgeordneten, aber das Wahlrecht war nicht gleich. Nach dem neuen Gleichheitsgrundsatz hätte man den Landtag neu wählen lassen müssen. Das schien den Konservativen im Land zu revolutionär! Bei einer Neuwahl des Landtags wäre vielleicht auch ein Wahlsieg der Republikaner zu befürchten gewesen! So blieb alles beim Alten – vorerst. Allerdings hatten laut „Wächter an der Murg“ rund 160 Bürger (also etwa 40 Prozent der wahlberechtigten Männer in Gernsbach) die Bitte um Auflösung des alten Landtags unterzeichnet und damit eine demokratische Umgestaltung befürwortet.
Konservative vorn bei Gemeinderatswahlen. Bestechung oder Angst vor Experimenten?
Im Januar 1849 hatten sich rund 21 Prozent der Gernsbacher Bürger im republikanischen Turnverein organisiert und etwa 40 Prozent für die von der Frankfurter Nationalversammlung eingeführten Grundrechte ausgesprochen. Die Partei der Republikaner wähnte sich im Aufwind. Umso ernüchternder fielen die Wahlen zum Gemeinderat am 12. Januar 1849 aus.
Von den acht Gemeinderäten war bei dreien, darunter Gustav Wallraff, die Amtszeit von sechs Jahren abgelaufen. Sie standen für eine Wiederwahl für weitere sechs Jahre zur Verfügung. Zwei Gemeinderäte schieden freiwillig aus, darunter Friedrich August Schickardt. Für sie mussten Ersatzmänner gewählt werden. Bei drei Gemeinderäten (Wilhelm Seyfarth, Jakob Rothengatter, Alois Haas) war eine Wahl nicht nötig, da ihre Amtszeit noch nicht abgelaufen war. Mit Seyfarth, Rothengatter, Haas, Wallraff und Schickardt war die Mehrheit des Gemeinderates vor der Wahl republikfreundlich gewesen. Das änderte sich nun. Gustav Wallraff wurde nicht wiedergewählt. Stattdessen kam der Konservative Wilhelm Grötz in den Gemeinderat. Seine Wahl (mit dem drittbesten Ergebnis) zeigte, dass sich die Wähler im Zweifelsfall doch eher für einen konservativen Kandidaten entschieden, bei dem keine politischen Experimente zu erwarten waren.
Kurz nach der Wahl erschien ein Artikel im „Wächter an der Murg“, der „Wahl-Bestechungen“ unterstellte. „Man bewirthete in mehreren Wirtshäusern längere Zeit vor der Wahl und unmittelbar darauf die willfährigen Wähler“, wie der anonyme Verfasser behauptete. Man habe, so heißt es weiter, bei etlichen auch den „Hang zur Trunkenheit“ ausgenutzt. Die Beschuldigung spielte möglicherweise auf die Besorgnis der Obrigkeit an, die Wirtschaftskraft der Stadt könne durch die Wirtshausdichte beeinträchtigt werden. Immerhin gab es allein an der Hofstätte schon sechs Wirte!
Der Initiator der angeblichen Wahlbestechung wird in dem Zeitungsartikel nicht genannt, erwähnt wird nur, dass es jemand sei, „dem eine wichtige öffentliche Stelle anvertraut ist“. War Amtmann Louis Dill gemeint? Wilhelm Grötz und einige Gleichgesinnte gingen davon aus und ließen eine Gegendarstellung veröffentlichen, in der sie den Artikel über die angeblichen „Wahl-Bestechungen“ als „Schandartikel“ anprangerten.
Die Gegendarstellung im „Wächter“ beschreibt die Reaktion der Bevölkerung auf den „Schandartikel“ genauer. Es habe, so die Zeitung, einen Auflauf gegeben. Etwa 150 Bürger hätten sich, so heißt es, versammelt, um ihrer Empörung über den Wahlbestechungs-Artikel Luft zu machen. Bürgermeister Drissler, der „von der immer mehr aufgeregten Versammlung Schlimmes fürchtete“, habe den Gemeinderat, den Bürgerausschuss, Teile der Bürgerwehr-Führung und Amtmann Dill ins Rathaus geladen, wo der republikanisch gesinnte Murgschiffer Casimir Griesbach schließlich zugab, den umstrittenen Artikel verfasst zu haben. Er musste öffentlich widerrufen, tat dies aber auf zweideutige Weise, indem er erklärte, er sei gern bereit, „diesen Artikel hiermit zu widerrufen“ in dem Fall, dass er „möglicherweise falsch berichtet“ sei.
Dem Amtmann Dill war das nicht genug. Er wandte sich an die Kreisregierung und ans Innenministerium mit dem Ansinnen, gerichtlich gegen Griesbach vorzugehen, was die Behörden jedoch ablehnten. Erstens war Dill in dem „Schandartikel“ nicht namentlich erwähnt, und zweitens war die großherzogliche Regierung nicht daran interessiert, einen möglichen Korruptionsfall vor einem der neu eingeführten Schwurgerichte (also öffentlich und vor unabhängigen Richtern) verhandeln zu lassen. Wählerbeeinflussung durch Behörden war bis vor kurzem schließlich nichts Ungewöhnliches gewesen.
Die nächste Gemeinderatswahl am 15. Juni 1849, die bereits nach Ausbruch der Revolution am 13. Mai 1849 stattfand, ging wieder zugunsten der Konservativen aus. Bei einer Wahlbeteiligung von 65 Prozent (244 Wähler bei 375 Wahlberechtigten) erzielte Wilhelm Grötz das beste Ergebnis (236 von 244 möglichen Stimmen). Die Republik-Anhänger Jakob Rothengatter, Bockwirt Seyfarth und Ölmüller Alois Haas erhielten deutlich weniger Stimmen. Der stadtbekannte Republikaner Gustav Wallraff schaffte es wieder nicht, in den Gemeinderat gewählt zu werden. Dagegen war Johann Carl Drissler kurz vorher am 8. Juni 1849 mit großer Mehrheit zum dritten Mal seit 1838 zum Bürgermeister gewählt worden (mit 260 von 266 möglichen Stimmen). Auch die Konservativen hielten ihn offenbar für den besten Mann in diesem Amt – trotz seiner demokratischen und republikfreundlichen Gesinnung. Vielleicht vertrauten sie auf den mehrheitlich konservativen Gemeinderat als ausgleichendes Element.
Preußischer König lehnt die Kaiserkrone ab. Ist die deutsche Einheit noch zu retten?
Seit dem Ende des Jahres 1848 standen sich die politischen Lager in Gernsbach zunehmend unversöhnlich gegenüber. Zu den nach damaliger Vorstellung „entschiedenen Demokraten“ gehörten diejenigen, die ein geeinigtes Deutschland als parlamentarische Republik wollten. Die Konservativen und gemäßigt Liberalen bevorzugten dagegen eher ein Deutschland unter monarchischer Leitung mit einer begrenzten Mitsprache des Volkes. Daneben gab es noch die Vertreter der Reaktion, die jegliche Mitbestimmung des Volkes ablehnten. Bis März 1849 änderte sich an dieser Situation kaum etwas.
Am 21. März 1849 berichtete die republikfreundlich gesinnte, in Gernsbach erscheinende Zeitung „Wächter an der Murg“ über die Wahl des Verwaltungsrates der Murgschifferschaft: „Das conservative Element ist total unterlegen, gewählt wurden die Herren Kast, Schickardt, Griesbach, Klehe und Bucherer, lauter Männer des Fortschritts, zum Theil von der entschiedensten Gesinnung.“ Gleich im Anschluss an diese Meldung wird ein besonders reaktionäres Mitglied der Gernsbacher Honoratioren erwähnt, nämlich der evangelische Diakon Dr. Friedrich Kayser (1817-1857). Seit 1844 zweiter Geistlicher neben dem evangelischen Stadtpfarrer, war er auch als Lehrer für die Lateinschule zuständig. Großherzog Leopold hatte am 16. März 1849 gemäß der von der Nationalversammlung beschlossenen Grundrechte die Todesstrafe in Baden abgeschafft, was Kayser als eine Zerstörung der „göttlichen Grundlagen des Staatslebens“ öffentlich kritisierte. Der Obrigkeit das „Richtschwert aus der Hand zu nehmen“, verstoße, so Kayser, gegen die Bibel. Der Redakteur des „Wächters“ urteilte über den Diakon, er sei „ein sehr geistreicher, kenntnißreicher und sehr frommer Mann“, aber seine Haltung beweise, „daß man bei aller Frömmigkeit auch grausam sein kann.“
Ende März änderte sich die politische Situation grundlegend. Am 28. März 1849 wurde die von der Frankfurter Nationalversammlung erarbeitete und sehnsüchtig erwartete Reichsverfassung verkündet und trat damit, zumindest nach dem Selbstverständnis der Abgeordneten, unmittelbar in Kraft. Oberhaupt des geeinten deutschen Reiches sollte ein erblicher, aber durch ein Parlament in seiner Macht eingeschränkter „Kaiser der Deutschen“ sein. Republikaner und Liberale hatten sich in der Paulskirche auf eine Balance zwischen monarchischem Prinzip und Volkssouveränität geeinigt. „Kaiser der Deutschen“ sollte der König des größten deutschen Einzelstaates Preußen werden. Die Aufgabe der verfassunggebenden Nationalversammlung war damit erfüllt – zumindest theoretisch. Die praktische Umsetzung drohte jedoch zu scheitern. Zwar wurde die Reichsverfassung am 14. April von 28 kleineren und mittleren Staaten (darunter Baden) anerkannt. Preußen, Sachsen, Bayern und Hannover jedoch lehnten sie ab. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. schlug die ihm von der Nationalversammlung angebotene Kaiserkrone am 28. April aus. Er fühlte sich nach wie vor als Herrscher „von Gottes Gnaden“. Eine vom Parlament verliehene Krone war für ihn nicht akzeptabel. Viele fragten sich, ob die Einheit Deutschlands noch zu retten sei.
Der Gernsbacher „Wächter“ sah eine neue Revolution voraus, aber diesmal unter Beteiligung „auch der gemäßigt liberalen Elemente, welche das Fürstenthum gestützt hatten“. Diese Prognose erwies sich als richtig. Am 8. Mai 1849 erklärte der konservativ gesinnte Teil der Gernsbacher Bürgerwehr, der sich noch im Dezember 1848 geweigert hatte, an der Gedenkfeier für den in Wien getöteten Republikaner Robert Blum teilzunehmen (wir berichteten), in einem Flugblatt seine Bereitschaft, „die Reichsverfassung gegen jeden verfassungsverletzenden Angriff zu vertheidigen“. In diesem Ziel schienen die konservativen Bürgerwehrmänner nun trotz aller politischen Gegensätze mit ihren republikanisch gesinnten Mitbürgern einig. In den folgenden Wochen kam es zur sogenannten „Reichsverfassungskampagne“ mit den Schwerpunkten in Sachsen, der bayerischen Pfalz und in Baden. Das Volk verlangte die Durchsetzung der in Frankfurt beschlossenen Reichsverfassung.
Dabei spielten in Baden besonders die Volksvereine eine herausragende Rolle. Seit dem Beschluss der Grundrechte durch die Nationalversammlung Ende 1848 hatten sich aufgrund der Vereinsfreiheit zahlreiche republikanisch gesinnte Volksvereine gebildet. Auch in Gernsbach war Anfang Mai 1849 ein solcher Verein gegründet worden, dem auf Anhieb 100 Männer beitraten. Am 6. Mai fand eine Versammlung von Volks- und Turnverein im großen Saal des Badischen Hofs statt, um das weitere Vorgehen zu beraten. Die Stimmung in Gernsbach näherte sich dem Siedepunkt – so wie in ganz Baden.
Der Ausbruch der Revolution 1849 in Gernsbach
„Mitbürger! Die bedrohliche Lage des Vaterlandes macht es nothwendig, daß das Volk sich bereit hält, sein Recht und seine Freiheit mit den Waffen zu schirmen!“ Dieser vom 1. Mai 1849 datierende Aufruf der badischen Volksvereine war am 5. Mai in der in Gernsbach erscheinenden Zeitung „Wächter an der Murg“ nachzulesen. Mit „Verfassung“ war die Reichsverfassung gemeint, die von der Nationalversammlung für ganz Deutschland im März 1849 verkündet, aber im April von den Königen von Preußen, Bayern, Sachsen und Hannover abgelehnt worden war.
Daraufhin brach Anfang Mai 1849 eine Welle von Aufständen aus, die als „Reichsverfassungskampagne“ bezeichnet wird. In mehreren deutschen Einzelstaaten begehrte die Bevölkerung auf, um besonders die in der Reichsverfassung verankerten und mittlerweile als unantastbar betrachteten Grundrechte durchzusetzen, notfalls auch mit Gewalt. Die Bewegung begann in der zu Bayern gehörenden linksrheinischen Pfalz. Auf einer Volksversammlung in Kaiserslautern beschloss man Volksbewaffnung und Steuerboykott. In Baden übernahmen die Volksvereine die Organisation des Widerstands. Der badische Finanzbeamte Amand Goegg (1820-1897) aus Renchen hatte seit Ende 1848 ein landesweites Volksvereinsnetz aufgebaut, das im Mai 1849 etwa 500 Vereine mit über 40.000 Mitgliedern umfasste (etwa 16 Prozent der erwachsenen männlichen Bevölkerung). In zahlreichen Versammlungen, Zeitungsartikeln und Flugblättern wurde die Bevölkerung über ihre demokratischen Rechte aufgeklärt.
Nachdem der Volksaufstand in Sachsen zwischen dem 5. und 9. Mai durch preußische Truppen blutig niedergeschlagen worden war, lud sich die Stimmung auch in Baden immer mehr auf. In Gernsbach hatte das Blatt „Wächter an der Murg“ laufend über die Vorgänge in Dresden berichtet. Zwar hatte Großherzog Leopold die Reichsverfassung mit 27 anderen kleineren Staaten anerkannt, aber ob sich die konservative badische Regierung gegen den preußischen Druck zur Abschaffung der Reichsverfassung würde behaupten können oder wollen, schien fraglich. Am 12. Mai hatte der Vorstand der Volksvereine daher zu einem Kongress nach Offenburg geladen. Die Delegierten der Volksvereine wollten Beschlüsse zur Bewahrung der Reichsverfassung und zur demokratischen Neuordnung in Baden fassen und sie am nächsten Tag, dem 13. Mai, von einer großen Volksversammlung bestätigen lassen.
Als Delegierter des Volksvereinkongresses am 12. Mai fuhr der Gernsbacher Ratsschreiber Raphael Weil nach Offenburg. An der großen Volksversammlung am nächsten Tag nahmen etliche Gernsbacher teil, unter anderem Gustav Wallraff, der Wirt des Badischen Hofes, der Geschäftsmann Veit Kaufmann (beide Mitglieder des demokratischen Turnvereins) und das Musikkorps des Turnvereins, das bei jedem Halt des Zuges und auf der Rednertribüne in Offenburg in den Pausen aufspielte. Allen Daheimgebliebenen war klar, dass es in Offenburg zu weitreichenden Beschlüssen kommen würde. Das Flugblatt mit den Forderungen der Offenburger Versammlung, das Gustav Wallraff bei seiner Rückkehr am Abend des 13. Mai mitbrachte, riss man ihm vermutlich aus den Händen. Es wurde unter anderem die Entlassung der Regierung, eine demokratische Neubildung des Staates und Volksbewaffnung verlangt. Auch soziale Forderungen wurden erhoben wie zum Beispiel eine progressive Einkommenssteuer und ein Pensionsfonds zur Versorgung von Arbeitsunfähigen. Die erste Forderung aber war: „Die Regierung muß die Reichsverfassung unbedingt anerkennen und mit der ganzen bewaffneten Macht unterstützten.“
Die „bewaffnete Macht“, das badische Heer, stand diesmal auf Seiten des Volkes. Zwischen dem 9. und dem 12. Mai schlossen sich zunächst die Soldaten der größten badischen Garnison Rastatt der Volksbewegung an, was im Wesentlichen durch die Fehlentscheidungen der Vorgesetzten einschließlich des Kriegsministers verursacht wurde. Am 13. Mai meuterten auch Truppen in Karlsruhe. Großherzog Leopold floh in der Nacht mit seiner Familie über den Rhein und begab sich schließlich in die preußische Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz. Da auch die Minister flohen, blieb das Land ohne Regierung zurück. Um das Machtvakuum zu füllen, bat der Karlsruher Gemeinderat den Landesausschuss der Volksvereine, in die Hauptstadt zu kommen und die Regierung zu übernehmen. Als Vertreter ernannte diese neue Regierung sogenannte Zivilkommissare, die in die einzelnen Bezirksämter zur Durchführung des neuen Regierungskurses geschickt wurden. Als Zivilkommissar für das Murgtal kehrte Ratsschreiber Raphael Weil am 14. Mai nach Gernsbach zurück. Damit hatte die Revolution auch hier Einzug gehalten.
Die Revolution will Ordnung und Sicherheit auch in Gernsbach
„Montag den 14. Mai erschien in Gernsbach der Commissair der am 13. Mai in Offenburg abgehaltenen Landesversammlung, Bürger Weil, auf dem Rathause und erklärte ´Alle öffentlichen Beamten des Amtes Gernsbach sind ihrer Stelle enthoben´, und setzte als provisorische Centralgewalt für das Murgthal den Gemeinderath daselbst und den Vorstand des Volksvereins, Bürger Kürzel ein.“ So lautet ein Bericht der neu eingerichteten „Centralgewalt für das Murgtal“ vom 18. Mai 1849 an den Landesausschuss der Volksvereine in Karlsruhe.
Der Landesausschuss hatte am 14. Mai 1849 nach der Flucht des Großherzogs und seiner Minister in Karlsruhe die Macht übernommen und eine vorläufige Regierung mit dem populären Anwalt Lorenz Brentano an der Spitze gebildet, um die Reichsverfassung zu sichern und eine geordnete Regierung des Landes aufrechtzuerhalten. Damit war die Revolution in Baden ausgebrochen. Um ihre Anordnungen im ganzen Land umzusetzen, schickte die revolutionäre Regierung sogenannte „Civilcommissäre“ in die einzelnen Amtsbezirke. Einer von ihnen war Raphael Weil, seit 1847 Gernsbacher Ratsschreiber, der nun für die Organisation der neuen Macht im Murgtal zuständig war, wobei er von einem sogenannten Zentralausschuss unterstützt wurde, der aus Bürgermeister Drissler, den Gernsbacher Gemeinderäten und dem Mediziner Franz Kürzel bestand.
Weil erließ seine Anordnungen „im Namen des souveränen Volkes“. Diese radikal-demokratische Haltung wurde allerdings von den meisten Mitgliedern der neuen Regierung in Karlsruhe nicht unterstützt. Besonders Brentano hätte lieber eine liberale Reform des Staates mit einer zwischen Volk und Großherzog geteilten Souveränität gesehen und wollte dem geflohenen Herrscher die Rückkehr nicht völlig verbauen. Auch aus diesem Grund beließ man die großherzoglichen Beamten auf ihren Posten, sofern sie den Eid auf die Reichsverfassung ablegten. Am 20. Mai schworen auch die Gernsbacher Beamten vor Bürgermeister Drissler und Zivilkommissar Weil, „die Reichsverfassung aufrecht zu erhalten und sie gewissenhaft zu vollziehen“, allerdings unter dem Vorbehalt, dass der neue Eid nicht gegen ihren ursprünglichen Beamteneid auf die großherzogliche Verfassung und damit auch den Großherzog verstieß. Diese Klausel machte den neuen Eid auf die Reichsverfassung eigentlich wertlos. Der einzige in Gernsbach, der den Eid dennoch Gewissensgründen verweigerte, war der evangelische Diakon Friedrich Kayser. Dennoch beließ man ihn im Amt. Man wollte keinen Umsturz um jeden Preis. Radikale Republikaner wie Weil waren in der Minderheit. Dem Gernsbacher Zentralausschuss, also dem Gemeinderat, war nach eigener Aussage wichtig, dass „die Bewohner des Murgthales in gesetzlicher Ordnung sich befinden und die Sicherheit der Person und des Eigenthums geschützt ist“.
Eine radikale Maßnahme Weils, die von den Gernsbachern unterstützt wurde, war dagegen die sofortige Entlassung der Beamten. Obwohl die Regierung in Karlsruhe diese Maßnahme zunächst wieder rückgängig machte, musste sie den vehementen Forderungen der Gernsbacher schließlich doch nachgeben und drei besonders unbeliebte Staatsdiener, darunter den Amtsrichter Ludwig Dill, wenn auch nur vorläufig, entlassen. Revolutionär mutet auch die Meldung des Gernsbacher Zentralausschusses vom 18. Mai nach Karlsruhe an: „Die öffentlichen Gebäude der Stadt Gernsbach wurden unter den Schutz des Volkes gestellt. Das Schloß Eberstein mit Besatzung versehen.“ Schloss Eberstein befand sich im Privateigentum des Großherzogs. Seine Besetzung und mehrfache Durchsuchung wirkte sich bei den Hochverrats-Prozessen nach Niederschlagung der Revolution als besonders radikaler Akt für die Teilnehmer erschwerend aus.
Am 23. Mai ernannte Zivilkommissar Weil die Mitglieder eines Sicherheits- und eines Wehrausschusses. Zum Sicherheitsausschuss gehörten Bürgermeister Drissler, Murgschiffer und Gemeinderat Wilhelm Grötz, Bockwirt und Gemeinderat Wilhelm Seyfarth, Badischer Hofwirt Gustav Wallraff und Murgschiffer Friedrich August Schickardt, zum Wehrausschuss Messerschmied und Gemeinderat Jakob Rothengatter, Ölmüller und Gemeinderat Alois Haas, praktischer Arzt Franz Kürzel, Büchsenmacher (Hersteller von Schusswaffen) Gabriel Möst und Apotheker Engelhard Sonntag. Der Sicherheitsausschuss, der sich bereits vorher gebildet hatte, berichtete bereits am 18. Mai: „Die Gemeinden des Amtes Gernsbach wurden aufgefordert alle waffenfähige Mannschaft von 18-30 Jahren, soweit wie möglich zu bewaffnen, mit Geld zu versehen und an die (Bahn)-Stationsplätze Oos und Muggensturm abzusenden.“ Die Mobilmachung zur Sicherung der freiheitlichen Errungenschaften wie Reichsverfassung und Grundrechte hatte begonnen.
|